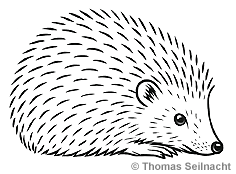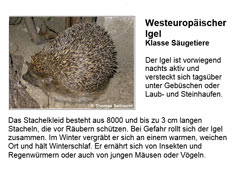Das Stachelkleid des Westeuropäischen Igels besteht aus bis zu 8000 und zwei bis drei Zentimeter langen Stacheln, die ihn vor Räubern schützen. Die Stacheln haben sich in der Evolution ursprünglich aus den Haaren entwickelt. Ein Stachel überdauert etwa eineinhalb Jahre, bevor er ausfällt und eine neuer nachwächst. Ein erwachsener Igel wiegt im Durchschnitt 500 bis 700 Gramm, nach dem Anfressen von Fettreserven im Herbst werden auch mehr als ein Kilogramm erreicht. Die Gliedmaßen sind sehr kurz, der Kopf ist mit einer langen, beweglichen Schnauze ausgestattet. Der Europäische Igel besitzt das typische Gebiss eines Insektenfressers. Gehör- und Sehsinn sind nicht so gut ausgeprägt, dafür haben Igel einen ausgezeichneten Geruchssinn. Eine Besonderheit ist das Jacobson-Organ, ein Riechorgan in der Nasenscheidewand, das übrigens auch bei Schlangen vorkommt. Die Gliedmaßen des Igels sind kurz, während die Hinterbeine etwas länger sind. Die Füße haben fünf Zehen, die jeweils mit Krallen besetzt sind. Beim Laufen setzen Igel die komplette Fußfläche auf, sie sind Sohlengänger.
Lebensweise
Die Igel sind überwiegend nachts aktiv und verstecken sich tagsüber unter Gebüschen oder in Laub- und Steinhaufen. Beim Laufen geben sie manchmal leise Schnaufgeräusche von sich oder sie niesen. Beim Fressen schmatzen sie relativ laut, bei großer Gefahr können sie sogar durchdringend schreien. Kommt man ihnen zu nahe, fauchen sie, was sehr bedrohlich wirkt. Igel findet man an Laubwaldrändern, in Weideland und Heckenlandschaften oder in kleinen Gehölzen. Aber auch in Gärten, Parks und Friedhöfen halten sie sich gerne auf. Nadelwälder und Monokulturflächen der Landwirtschaft werden gemieden.
Bei Gefahr rollt sich der Igel zusammen, es entsteht die typische Stachelkugel. Durch ein kompliziertes Zusammenspiel der Muskulatur werden die Stacheln aufgerichtet und der Körper so zusammengerollt, dass die weichen, ungeschützten Teile verborgen werden. Der Igel schätzt ab, wie groß die Gefahr ist, oft rollt er sich nicht vollständig zusammen, beispielsweise wenn ein Mensch ihn berührt.
Das Männchen durchwandert Gebiete mit einer Größe von bis zu 100 Hektar. Zur Nahrungssuche legt es nächtlich zwei bis drei Kilometer zurück, selbst Flüsse werden durchschwommen. Das Weibchen legt kürzere Strecken zurück. Trifft ein Männchen während der Paarungszeit auf ein Weibchen, wird dieses ausgiebig umkreist. Das Weibchen wehrt die Annäherungsversuche zunächst durch Fauchen und Stellen der Stacheln ab, in dem es dem Männchen die Seite zuwendet. Manchmal werben sogar mehrere Männchen um ein Weibchen, aber nur eines gelangt an sein Ziel. Das Igelkarusell mit den damit verbundenen Schnarch- oder Säge-Geräuschen in der Nacht kann stundenlang dauern, bis es schließlich doch zu einer Paarung kommt. Dabei besteigt das Männchen das Weibchen von hinten, das die Stacheln flach ablegt. Nach der Begattung geht das Männchen wieder weg und sucht nach weiteren Partnerinnen.
Nach etwa fünf Wochen bringt das Weibchen vier bis fünf Junge zur Welt. Dafür baut es ein Nest in einem hohlen Baum, in einem Reisighaufen oder unter einem Holzstoß. Dieser Bau wird innen sorgfältig mit Moos, Laub und Gras ausgepolstert. Die Igelmutter reagiert direkt nach der Geburt besonders sensibel auf Störungen. Es kommt vor, dass sie ihren Wurf verlässt oder die Jungen tötet. Sind die Jungen schon älter, trägt sie diese bei Störungen an einen anderen Ort. Sie werden sechs Wochen lang gesäugt, nach neun Monaten sind sie selbst geschlechtsreif. Ein Igel kann zehn Jahre alt werden, manchmal sogar noch älter. Bei den jungen Igeln im Nest ist die Sterblichkeit am höchsten, von fünf jungen Igeln überlebt oft nur einer.
Im Oktober oder November vergräbt sich der Igel an einem warmen, weichen Ort und hält Winterschlaf. Dafür baut er ein kugelförmiges Nest oder sucht einen Reisighaufen auf. Die normale Körpertemperatur von 36 °C sinkt im Winterschlaf mehr als 30 °C ab, der Igel atmet dann nur noch ein oder zweimal pro Minute, das Herz schlägt nur noch fünfmal pro Minute. Damit der Igel den halbjährigen Winterschlaf überlebt, muss er zu Beginn mindestens ein Körpergewicht von einem halben Kilogramm angefressen haben. Im April kriecht er dann aus seinem Versteck hervor, um sich möglichst bald wieder zu paaren.
Nahrungserwerb
Der Westeuropäische Igel ernährt sich von Insekten wie Käfer, Ohrwürmer oder Schmetterlingsraupen, von Regenwürmern und Schnecken, gelegentlich aber auch von jungen Mäusen oder von Vögeln. Die Eier von Bodenbrütern wie Möwen, Seeschwalben, Feldlerchen, Hühnervögeln oder von Piepern können ebenfalls einem Igel zum Opfer fallen.
Gefährdung
Gefährlich wird es für den Igel, wenn sich Dachs, Baummarder, Fuchs, Steinadler oder Uhu nähern. Geschwächte Igel fallen auch Wildschweinen, wildernden Hunden oder Rabenkrähen und Elstern zum Opfer. Gefahr droht auch durch Parasitenbefall. Flöhe, Zecken, Fliegenmaden und Milben machen den Igeln schwer zu schaffen. Besonders gefährlich ist eine innere Infektion mit Würmern wie dem Lungenhaarwurm, dem Darmhaarwurm oder dem Igelbandwurm. Diese Parasiten fangen sich die Igel ein, wenn sie Schnecken fressen. Findet man einen erkrankten oder geschwächten Igel, sollte man ihn nur mit Handschuhen anfassen und die Hände danach gut waschen. Der Tierarzt kann eine Spritze gegen die Würme verabreichen oder die äußeren Parasiten mit einem Spray bekämpfen.
Artenvergleich
Der Westeuropäische Igel wird auch Braunbrustigel genannt. In Mitteleuropa lebt aber noch eine weitere Igelart: Der Nördliche Weißbrustigel Erinaceus roumanicus Barrett-Hamilton, der auch Osteuropäischer Igel genannt wird, findet sich in weiten Teilen Osteuropas bis weit hinein nach Russland. Bei dieser Art ist das Fell an der Brust deutlich heller gefärbt. In Österreich und Ungarn überschneiden sich die Lebensräume der beiden Arten teilweise.
Fotos, Grafiken und Film